Gefärbtes Licht
Von der Dunkelkammer her wissen wir, daß bei Rotlicht alle Gegenstände
ihre "Eigenfarbe" verlieren, die einzige Farbe, die es dann
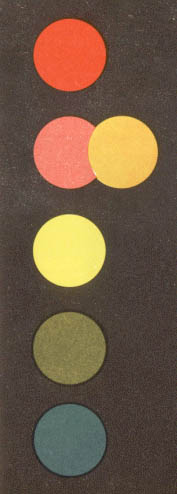 |
Tiefrot.
Zur Entwicklung von orthhochromatischem negativ-Material, da dieses
für Rot nicht empfindlich ist.
Hellrot oder Orange. Für Bromsilber-
(Vergrößerungs-)Papiere. Tiefrot nicht erforderlich,
da Papiere weniger allgemeinempfindlich als Negativ-Schichten.
Empfehlenswerter jedoch das grüngelbe Filter, s. unten. Gelb. Für Kunstlicht-Kopierpapiere, daderen Empfindlichkeit
so gering ist, daß er schon genügt, wenn man durch
Gelb das Blau abschneidet, für das sie am stärksten
empfindlich sind. Grüngelb (Agfa Nr. 113). Ein sehr
empfehlenswertes Filter zur Entwicklung von Bromsilber-Papieren.
Nur im indirekten Licht zu verwenden, jedoch auch dann noch außerordentlich
hell. Verhindert im Gegensatz zu Rotlicht jede Täuschung
über die entwickelnden Tonwerte, Schneidet Blau und Blaugrün
restlos, ferner einen Teil des Rot ab. Tiefgrün. Für die Verarbeitung
von panchromatischen Schichten, da diese für Grün relativ
am schwächsten empfindlich sind. Schneidet insbesondere das
Rot ab, für das einige panchromatische Schichten besonders
hoch empfindlich sind (Typ
II und III, S. 35). |
Seite 198
zur
Inhaltsübersicht![]() zum
Stichwortverzeichnis
zum
Stichwortverzeichnis
noch gibt ist Rot. Das ist ein schönes Beispiel dafür, daß
ein Gegenstand immer nur eine Farbe haben kann, die in dem Lichte enthalten
ist, das ihn trifft.Treffen ihn z. B. nur die langwelligen Rotstrahlen,
so kann auch die Farbe, auf die er bei weißem Mischlicht "anspricht",
nicht aufleuchten. So erlöscht auch im Grünlicht jede andere
Farbe außer Grün usw.
Wir haben zeitweise das größte Interesse daran, gewisse Farbkomponenten
aus dem "weißen" Lichte herauszufiltern, beim Entwickeln
nämlich. Dann filtern wir das weiße Licht so, bis nur der
jeweils "ungefährliche" Farbanteil übrigbleibt,
ungefährlich deshalb, weil die Schicht auf diesen rechtlichen Farbanteil
nicht oder nur ganz schwach reagiert. Die wichtigsten Dunkelkammer-Filter
(oder auch Birnen aus gefärbtem Glas) sind die nebenan abgebildeten.
Gefärbtes Licht spielt auch bei der
Aufnahme eine große Rolle. Es verfärbt die Gegenstände.
Zwei Beispiele: das Morgen- und Abendlicht ist gelblich-rötlich.
Elektrisches Licht ist nahezu orangefarben. Jeder hat sicher schon beobachtet,
wie bei diesem Lichte z. B. ein normalerweise leuchtendes Blau schmutzig
und schwärzlich erscheint. Der Grund ist einfach: dieses Licht
ist so blauarm, daß das Blau nicht zum Aufleuchten kommt. Wieder
der Fall: die Farbe, die nicht oder ungenügend im Lichte enthalten
ist, kann auch nicht oder nicht genügend in Erscheinung treten.
Ähnlich liegt es mit bläulich gefärbtem Licht (Schneelicht,
auf hohen Bergen, usw.). Dann fehlt stark die Gelb-Rot-Komponente.
Bei alledem wollen wir uns vor allem über eins klar sein: genau
so "verschoben" wie für unser Auge wir dann auch für
die fotografische Schicht das Bild, d.h. sie zeigt bei gefärbtem
Licht auch entsprechend andere Tonwerte. Wie stark die Verschiebung
ist, sieht man an den Lagorio-Kurven auf S. 37, die die farb-Verschiebung
bei Nitralicht zeigen. Wenn also Licht in der Zusammensetzung seiner
Wellenlängen sehr verschieden sein kann, so darf man zeitweise
sogar die Frage stellen:
"Auf welcher
Wellenlänge fotografieren Sie?"
Sehen wir uns die Zeichnung auf der nächsten Seite
an: Denken wir einmal an das gelblich-rötliche Licht elektrischer
Birnen. Gelb ist ein Gemisch aus Grün und Rot. Daher wird Grün
und Rot (das sogarim Überschuß vorhanden ist) bei diesem
Lichte auch entsprechend betont. Insbesondere die Rotwiedergabe steigt.
Seite 199
zur
Inhaltsübersicht![]() zum
Stichwortverzeichnis
zum
Stichwortverzeichnis
Deshalb ist Film Typ I (S.
37) bei diesem Lichte praktisch tonrichtig. An den Kurven
auf S.
37 sieht man aber auch wie gefährlich dann die Rotwiedergabe
bei Typ III steigt.
 |
Gelbliches Licht. Abends,
früh am Morgen und Licht elektrischer Birnen. Gelb= Gemisch aus Rot und Grün. |
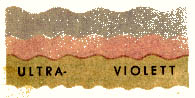 |
Die kurzen Wellen, Blau, Violett und Ultraviolett (nicht sichtbar), wiegen vor. Wirkung etwa die eines Blaufilters. Bei Schnee (Blau vorwiegend) Ausgleich durch Gelbfilter. Im Hochgebirge (Ultraviolett vorwiegend) Ausgleich durch UV-Filter (s. S. 211, 212) Bläulisches Licht. In geringem Maße mittags, vor allem aber mittags im Hochgebirge. Ferneer im Winter bei Schnee. |
Ein weiteres Beispiel dafür,
daß, wie schon in Goethes Farbenlehre festgestellt wird, "farben
Taten des Lichts" sind, daß also von der Zusammensetzung
des Lichtes die jeweilige farbigkeit von Pigmenten abhängt: gewisse
Spezial-Lampen (Quecksilberdampf, Höhensonne) geben z.B. der
menschlichen Haut ein leichenhaftes Aussehen. Diesem Licht fehlt die
Gelb-Rot-Komponente, sie kann also auch nicht reflektiert werden.
Alle diese Zusammenhänge sind fotografisch oft von Belang, insbesondere,
wenn es sich um letzte Feinheiten in der Tonwertwiedergabe handelt.
Denn die fotografische Schicht kann selbstverständlich nur die
Farbigkeit registrieren, die jeweils vorhanden ist.
Aus der Lehre vom Lichte und der Farbe gewinnen wir noch weitere Erkenntnisse,
die zeigen, mit welchen großen Zusammenhängen die Fotografie
verkettet ist, - oft darf man auch sagen: in welche Komplikationen
sie verwickelt ist.
Wir haben viel mit dem blauen Himmel, mit blauen Mittagslicht, mit
gelblichem Abendlicht, mit dem bläulichen Luftschleier der Ferne
und überhaupt viel mit der Atmosphäre zu tun, und da wir
über diese Dinge nachzudenken pflegen, stellen wir eine Frage,
die vielleicht ein Kind stellen, einen Erwachsenen aber möglicherweise
verlegen machen könnte.
Seite 200
zur
Inhaltsübersicht![]() zum
Stichwortverzeichnis
zum
Stichwortverzeichnis
Wie
entsteht das Himmelsblau und das Abendrot?
(Siehe die Zeichnung a. d. nächste Seite.)
Die Farben der Atmosphäre
entstehen durch Beugung.
Der Weg des Lichtes ist unsichtbar und dunkel. Er ist
stets nur an Körpern, die auf diesem Wege liegen, erkennbar.
Ein Spiegel, mit dem wir das Sonnenlicht auf eine Hauswand werfen,
läßt den Weg des Lichtes nicht erkennen. Nur da wo der
Zusammenstoß des Lichtes mit Materie stattfindet, an der Hauswand,
erscheinen uns die Lichtstrahlen als Licht. Blasen wir aber beispielsweise
Zigarettenrauch in den Weg des Lichtes, so wird der Strahl sichtbar,
gleichfalls nur als Reflexion an kleinen Materie-Teilchen. Gäbe
Sonne nur ein heller Ball, alles übrige in der Welt wäre
dunkel, - wir sähen die Sonne lediglich als Scheibe, umgeben
von nächtlichem Dunkel. ""ag""ist es bei
uns, weilringsum Licht gebeugt und gestreut wird.
Dann kann auch das Himmelsblau nur Streulicht sein. Aber warum ist
es blau? Warum wird nur das kurzwellige blaue Licht sichtbar? Weil
nur dieser Anteil des weißen Lichtes Streukörper findet,
an denen er sich brechen kann. Für die kurzwelligen Strahlen,
die wir als Blau empfinden, genügen zur Berechnung, zur Reflexion,
schon die Luftmoleküle. Sie sind grob gegen die unendlich kurze
Welle des blauen lichtes. Am blauesten ist der Himmel in der staubfreiesten
Luft, d. h. wenn nur Blau gebrochen und reflektiert wird. Treten roburstere
Streupartikel auf, z. B. die meist in der Atmosphäre schwebenden
Staupteilchen und Wasserdampf, so werden auch die längeren Wellen
(Gelb, Rot) gebrochen und treten damit als Licht in Erscheinung. Das
Gemisch ergibt dann ein milchiges Blau oder das trübe Grau einer
mit Staubpartikeln und Wasserdampf überladenen Atmosphäre.
Ähnlich verhält sich mit der "blauen Ferne". Zwischen
dem Beschauer und z. B. fernen Bergen befinden sich meilenweite Luftmassen.
Die Luftmoleküle brechen Blau. Je reiner die Luft, um so unvermischter
kommt Blau beim Beschauer an. Trüber wird es, wenn durch Staub-
und Dunstteilchen auch die längeren Wellen Grün, Gelb, Rot
gebrochen werden. Grau wird die Ferne, wenn massive Streukörper
wie Wasserdampf alle Strahlen brechen.
Muß das Licht einen außerordentlich langen Weg durch dunstige
und staubige Atmosphäre zurücklegen, nämlich bei tiefen
Sonnenstande am Abend, so werden durch die groben Staubpartikel vorwiegend
die langwelligen Strahlen gestreut. Sie allein kommen auch bei uns
an, die kurzwelligen blauen haben sich vorher schon durch Streuung
verausgabt, gewissermaßen totgelaufen, Gelb-Rot wiegt vor, -
am Himmel steht das Abendrot.
Seite 201
zur
Inhaltsübersicht![]() zum
Stichwortverzeichnis
zum
Stichwortverzeichnis
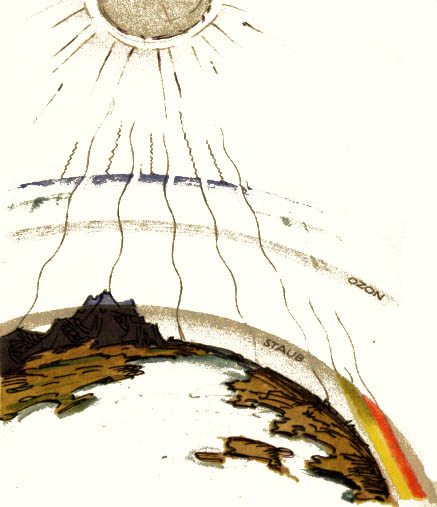
Wie das Himmelblau und das Abendrot entsteht.
(Die Veranschaulichung nimmt keine Rücksicht darauf, daß
die Sonnenstrahlen natürlich zu-
einander parallel auf die Erde fallen.)
Seite 202
zur
Inhaltsübersicht![]() zum
Stichwortverzeichnis
zum
Stichwortverzeichnis
An der Zeichnung sehen wir:
Oben: hoher Sonnenstand. Kurzwellige Strahlen durch die Moleküle
der Luft gestreut und dadurch sichtbar. Langwellige Strahlen (Gelb,
Rot) nicht sichtbar, da nicht gestreut. Blau am reinsten in staubfreier
Luft (Staubpartikel würden auch Gelb und Rot streuen und sich
mit Blau zu Weiß bzw. weißlichem Blau ergänzen).
Rechts unten: tiefer Sonnenstand. Das Strahlengemisch durchläuft
schräg eine dichte atmosphärische Staubschicht. Der atmosphärische
Staub streut die langwelligen Strahlen (Gelb, Rot), sie werden damit
sichtbar. Blau vorher durch Streuung ganz oder z.T. verausgabt, farbigstes
Abendrot bei tiefstem Sonnenstand (längstem Weg des Lichtes durch
die Staubschicht).
Etwa 50 km über der Erde liegt eine Ozondecke (dreiatomiger Sauerstoff),
die den größten Teil der der Ultraviolett-Strahlung absorbiert.
Die UV-Strahlung wird noch weiter durch die Staubschicht gedämpft.
In der staubfreien Luft hoher Berge tritt das UV-Licht immer noch
genügend in Erscheinung, es muß dann, da es fotografisch
Unschärfen bewirkt, durch UV-Filter herausgefiltert werden (s.S.
156 ""Optik"").
Die fotografisch wichtigsten Erkenntnisse, die sich
aus dem Verhalten des kurzwelligen und des langwelligen Lichtes ergeben,
sind folgende:
1. Panchromatische Schichten "verlängern den
Tag", den fotografischen Tag. Wird nämlich am späten
nachmittag das Licht gelber (wir empfinden es kaum, aber es ist so),
und wird es später sogar rötlich, so werten panchromatische
Schichten dieses Licht weit besser auch als orthochromatische, denen
die hohe Gelb-Rot-Empfindlichkeit fehlt.
2. Daß Gelb und
Rot die dunstige Atmosphäre (auch mitten am Tage) besser durchdringen
als Blau, wir von Belang bei fernaufnahmen, z.B. im Gebirge. Die gelb-rot-empfindliche
panchromatische Schicht reagiert etwas weniger als die ortchromatische
auf das die Ferne verschleiernde blaue Streulicht und verwertet etwas
besser die "durchdringende" Gelbrot-Komponente. Deshalb
"entschleiert" sie die Ferne in gewissem Maße. In
sehr hohem Maße sogar, wenn man ihr ein Rot- oder Orangefilter
vorschaltet. Dann zeigt die gefilterte Aufnahme in der ferne mehr
als das Auge sah. Trotz "weißen" Lichtes ist dann
die Aufnahmen nur mit Hilfe der Gelb-Rot-Strahlen, die dieses weiße
Licht enthielt, zustande gekommen, das die Ferne verschleiernde blaue
Streulicht wurde zum großen Teil herausgefiltert. In noch höherem
Maße wird die Ferne entschleiert, wenn man auf noch "längerer
Welle fotografiert", der infraroten, s.
S.216.
Seite 203
zur
Inhaltsübersicht![]() zum
Stichwortverzeichnis
zum
Stichwortverzeichnis
Das ist beim Himmelsblau,
beim Abendrot, außerdem aber noch bei Schmetterlingsflügeln,
bei Pfauenfedern, bei Perlmutter u.a.m. der Fall. Wir nehmen damit
Abschied von unserer kleinen und sehr unvollständigen fotografische
Farbenlehre. Aber wir tun es nicht, ohne uns noch kurz mit einer vierten
Möglichkeit der Entstehung von Farbe zu befassen: Farbe kann
auch durch Interferenz-Erscheinungen entstehen, ein fall, der uns
oft leider allzustark betrifft. Schon auf S.
145 sah man das Unheil, das sie anrichten: die Newton-Ringe,
und dort wird auch gesagt, wobei und weshalb sie zu unserem Kummer
vorhanden sind. Sie sind wahre Farben- und Formenwunder aus - nichts.
Noch gibt es - außer Behelfen - kein radikales Mittel gegen
sie. Sie können seuchenartig auftreten und dann auch den tapfersten
Mann aus der Dunkelkammer verjagen. Am nächsten Tag sind sie
dann vielleicht wie weggeblasen. Aber damit sind sie nicht ausgestorben,
sie sind lediglich ein Haus weitergezogen und nehmen sich den nächsten
vor. . . . .Hier sehen wir drei besonders gesunde Exemplare. Schön
sind sie. Aber wir können gern auf sie verzichten.

Die sichersten Maßnahmen gegen das Übel der
Newtonringe sind vorbeugende. Sie sind auf Seite
146 genannt.
Seite 204
zur
Inhaltsübersicht![]() zum
Stichwortverzeichnis
zum
Stichwortverzeichnis
Abschwächen mit Silberputzpomade*)
Größere Negative kann man dadurch partiell abschwächen,
daß man auf die zu stark gedeckten Stellen des (trockenen) Negativs
etwas Silberputzpomade bringt und die betreffenden Stellen so lange
mit der Pomade schleift, bis sie die genügende Transparenz haben.
Das Schleifen geschiet am besten mit der Fingerkuppe.
Architektur-Aufnahmen
Beste Beleuchtung: seitliche. Frontale Beleuchtung wirkt unplastisch.
Wird die Kamera etwas nach oben gerichtet, so scheinen die Gebäude
auf dem Bilde "umzukippen" (Abb.
Siehe S. 138). Anderseits drücken ausgesprochene "Sichten
von unten" oder von oben die Wucht eines Gebäudes besonders
stark aus. Objektive, die sich am besten für Architektur-Aufnahmen
eignen: Weitwinkel-Objektive. Der weite Blinkwinkel erfaßt nach
allen Seiten mehr als der normale.
Auge
Das menschliche Auge ist eine Kamera im Kleinen. Die Augenlinse entspricht
dem Objektiv, die Netzhaut der lichtempfindlichen Schicht. Die Wölbung
der Augenlinse ist jedoch variabel, d. h. durch stärkere oder
schwächere Wölbung ändert das Auge jeweils seine Brennweite
(Naheinstellung= stärkere Wölbung = kürzere Brennweite.
Ferneinstellung = schwächere Wölbung = längere Brennweite).
Auch die Lichtempfindlichkeit des Auges ist variabel, erstens durch
die Pupille, die etwa einer Blende entspricht, ferner durch die Adaption
des Augennerven. Infolgedessen kann das Auge einen weitaus größeren
Helligkeitsumfang erfassen als beispielsweise die fotografische Schicht.
Fotografische Bilder sind also hinsichtlich ihres Helligkeitsumfangs
stets nur Analogien zur Wirklichkeit (Ausführliches hierüber
S.
126).
Das Öffnungsverhältnis des Auges kann in dunkelen Räumen
1:2 betragen. Der Blindwinkel des Auges ist minimal, seine Kleinheit
wird durch die Änderung der Blickrichtung ausgeglichen. Auch
eine "Gelbscheibe" besitzt das Auge, den sog. "gelben
Fleck", der sich in der empfindlichsten Stelle der Netzhaut befindet.
*) Globus-Putzpomenade, Fr. Schulz jr., chem. Fabrik, Leipzig.
Seite 205
zur
Inhaltsübersicht![]() zum
Stichwortverzeichnis
zum
Stichwortverzeichnis![]() weiter
weiter
