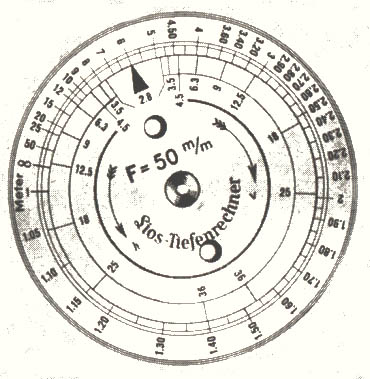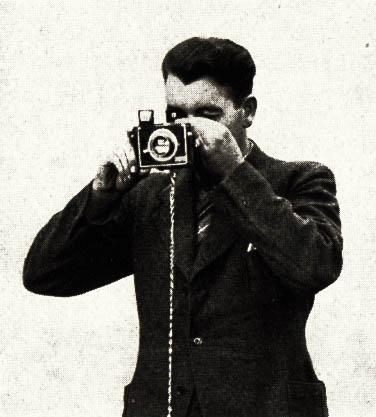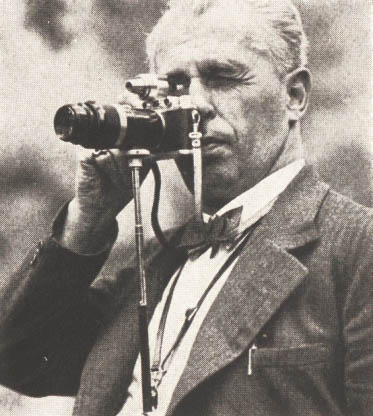Dunkelkammer - Sorgen
haben Sie zunächst noch nicht. Es gäbe die Kleinbild - Fotografie
nicht, wenn dazu unbedingt eine Dunkelkammer gehörte. Das war früher
so, als wir, die wir heute Lehrbücher schreiben, alles und jedes
selbst machen mußten. Wir haben freilich eine Menge gelernt dabei.
Wir haben Nächte auf dem Boden, im Keller oder im Badezimmer verbracht.
Das ist jetzt alles soviel einfacher. Auch weil die Fotohändler
jetzt soviel mehr leisten. Wir wollen uns auch ruhig darüber klar
sein: man ist noch lange kein öder Knipser, wenn man einfach nicht
die Zeit hat, sich zum Beispiel mit dem Entwickeln seiner Filme zu befassen.
Vom Kopieren und Vergrößern schon ganz abgesehen. Ewig unverständlich
wird bleiben, warum die Gruppen der ernsten und der todernsten Amateure
einschließlich ihrer Zeitschriften Den, der einfach nicht die
Zeit zu eigener Dunkelkammer - Arbeit hat, so gern als Knipser bezeichnen.
Gewiß, seine Erfolge sind billig und seine Mißerfolge vielleicht
grauenhaft, wenn er nicht einmal von der Aufnahme -Technik etwas versteht,
aber - er liefert uns dann wenigstens den billigen Film, denn ohne seinen
Massenverbrauch könnten wir den nicht bezahlen. Nützlich ist
der Gelegenheits - Amateur auch in dieser Ausführung.
Trozdem einen Vorschlag, - er ist erstens praktisch und er macht zweitens
sehr viel Freude. Wenn man sich nämlich eine Entwicklungsdose kauft
und seine kleine Film - Streifen selbst entwickelt.
Zu wissen braucht man positiv nichts, wenn man zu Hause abends in einem
verdunkelten Zimmer den Film in die Tageslicht - Dose (Abb.
Seite 27) eingelegt und die Dose dann mit ins Wohnzimmer
nimmt und lediglich auf die Uhr sieht, bis für den Entwickler vorgeschriebene
Zeit abgelaufen ist.
Und es macht, wie gesagt, eine Menge Freude. Man ist dann ohne großen
Aufwand schon "richtiger" Amateur.
Sie kaufen sich also Folgendes: eine Tageslicht - Entwicklungsdose (Abb.
S. 27). Ihr Händler wird ihnen die richtige für
ihr Format sagen. Dazu ein Thermometer. Denn die für jeden Entwickler
vorgeschriebenen 18°C muß bei der Dosenentwicklung haargenau
einhalten. Ferner 1 Dutzend Korkklammern und 2 Holzklammern mit Feder.
Zum Fixieren der Negative eine Büchse saures Fixiersalz. Und schließlich
eine grüne Osram-Birne.
Mit diesen Dingen begibt sich nun Folgendes:
Man schraubt die grüne Birne abends in eine Tisch- oder Schreibtischlampe,
verdunkelt das Zimmer, nimmt den Film aus der Kamera und bringt ihn
in die Dose, die mit Entwickler von genau 18°C gefüllt ist.
Das grüne Licht ist sehr schwach, man muß das Auge einige
Minuten daran gewöhnen. Aber dafür schadet es dem panchromatischen
Film nichts. Man schließt die Dose und kann nun mit ihr ins Helle
gehen (zum Beispiel auch ans Tageslicht).
Seite 24
Es gibt sogar sogenannte Tageslicht-Automaten
unter den Entwicklungs-Dosen, bei denen auch das Einlegen des Films
bei Tageslicht erfolgt (s.S.27).
Damit die Entwicklung gleichmäßig vor sich geht, muß
der Entwickler in der Dose auf irgeneine Weise bewegt werden. Ist ein
von außen drehbarer Spulenkern vorhanden, so dreht man ihn in
kleinen Zeitabständen. Oder man schüttelt die ganze Dose in
leicht drehender Bewegung (am besten beide Bewegungen gleichzeitig).
Die Entwicklung dauert je nach der
Vorschrift für den betreffenden Entwickler (s.S.100
unten) ca. 8 - 20 Minuten. Die
Entwicklungszeit ist im übrigen ausschlaggebend für das Gelingen
der Dosen-Entwicklung. Da sie von Fabrikat zu Fabrikat schwankt, geht
man am sichersten, wenn man mit einem Entwickler arbeitet, der die jeweilige
Zeit genau für das jeweiligen Filmfabrikat angibt. Ein solcher
Feinkorn-Entwickler ist zum Beispiel W 665 (Perutz). Man darf von den
W 665 angegebenen Entwicklungszeiten nicht wesentlich abgehen.
In der gleichen Dose, in der der Film
entwickelt wurde, wird er nach Abgießen des Entwicklers fixiert
(das, was fixiert, d. h. festgehalten wird, ist das entwickelte negative
Silberbild), im Mittel eine Viertelstunde, genaue Angaben werden sie
in der Gebrauchsanweisung zur Entwicklungsdose finden. Und schließlich
haben Sie den Film nur noch zu wässern. Dazu füllen Sie ein
Waschbecken fast bis zum Rande mit Wasser. In Abständen von ca.
10 cm befestigen Sie an der einen Längskante des Films Korkklammern
und hängen nun den Film schwimmend ins Wasser. Damit er sich nicht
zusammenrollt, verbinden Sie seine beiden Enden besonders mit einer
Korkklammer. Jetzt können Sie den Film zwei Stunden lang sich selbst
überlassen. Nur die Angriffspunkte der Korkklammern wechseln Sie
alle halbe Stunden. Nach zwei Stunden ist automatisch sämtliches
Fixiernatron aus Ihrem Film zu Boden gerieselt, denn es ist spezifisch
schwerer als Wasser. Der Film ist dann ausgewässert (aber Sie müssen
das Fixiernatron natürlich auf dem Boden lassen, dürfen also
das Wasser nicht unnötig aufrühren). Man kann auch in der
Dose selbst wässern, indem man sie mit einem Gummischlauch an die
Wasserleitung anschließt. Nun hängen Sie Ihren Filmstreifen
zum Trocknen auf, und zwar freischwebend an einer Metallklammer an einem
staubfreien Orte. An das untere Ende des Streifens klemmen Sie dann
eine Holzklammer, damit der Film sich nicht rollt. Nach ein paar Minuten
nehmen Sie ein kleines Stück ganz weiches Rehleder, weichen es
im Wasser auf und drücken es vollkommen aus. Mit dem Rehleder saugen
Sie sehr sorgfältig die Tropfen ab, die sich inzwischen stellenweise
auf der Schicht gesammelt haben. Würden Sie das nicht tun, so bekämen
Sie an diesen Stellen vielleicht Trocknungsränder. Nur die Tropfen
auf der Schichtseite brauchen Sie abzusaugen. Zeigen sich nach dem Trocknen
Tropfenspuren auf der Rückseite des Films, so haucht man diese
Streifen an und reibt sie (auf glatter Unterlage) vorsichtig mit einem
Wattebausch ab.
Seite 25
zur
Inhaltsübersicht![]() zum
Stichwortverzeichnis
zum
Stichwortverzeichnis
Alles das machen Sie am besten abends, denn nun können
Sie beruhigt zu Bett gehen und am nächsten Morgen ist Ihr Film
trocken. Da inzwischen niemand das Zimmer betreten hat, ist er auch
völlig frei von Stäubchen (denn Stäubchen auf Kleinbild-Negativen
können auf der Vergrößerung zu einigem Format kommen!).
Ehe Sie sich zur Ruhe begeben, tun Sie noch
etwas Lobenswertes: Sie spülen Ihre Entwicklungsdose tadellos aus.
Falls sie mit einem Zelluloidband arbeitet, sog. Correxband, spülen
Sie auch das sehr gut ab und stellen bzw. hängen beides zum Trocknen
auf. Denn die kleinsten Rückstände von Fixiernatron wären
Gift für die Entwicklung Ihres nächsten Films. Die Fixiersalzlösung
heben Sie sich im übrigen in einer großen Flasche auf.
Entwickeln kann also heute ein Kind. Und es wäre merkwürdig,
wenn Sie nicht dieselbe kindliche Freude am Entwickeln hätten,
die wir alten, ernsten und manchmal geradezu todernsten Amateure immer
wieder daran haben.
Falsch machen können Sie nichts.
Höchstens eins. Sie haben noch nicht die geradezu panische Angst,
die die alten Amateure vorm Fixiernatron haben. Das beginnt schon beim
Lösen des Fixiernatrons im Wasser. Dabei darf das Pulver nicht
stieben. Deshalb geht man besser in ein anderes Zimmer, wenn man die
Lösung herstellt. Außerdem darf man nicht Wasser auf Fixiernatron
gießen, denn dann verbäckt es zu einem Klumpen, der sich
schwer löst. Man gibt es mit einem Hornlöffel in kleinen Dosen
in das Wasser und rührt um. Und da die Lösung Kälte entwickelt,
setzt man sie eine halbe Stunde vorm Entwickeln an, damit sie bis dahin
einigermaßen auf Zimmertemperatur kommt.
Sie werden auf Ihren ersten selbstentwickelten Film sehr stolz sein.
Sie haben ihn ganz und gar selbst geschaffen.
Seite 26
8 kleine, aber wertvolle Helfer
 |
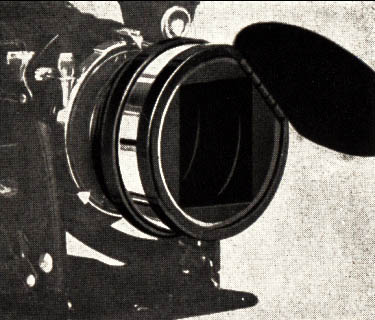 |
| 1.) Foto-elektricher Belichtungsmesser ("Sixtus", von Gossen). Nicht billig und doch auf lange Sicht billiger: durch vermiedene Fehlaufnahmen. Besser schlichte Kamera und wertvoller Belichtungsmesser als umgekehrt. | 2.) Eine Gegenlichtblende (Wörsching). Zu jeder Kamera gibt es die passende Gegenlichtblende und jede Aufmahme gewinnt durch sie -auch bei schräg seitlichem Sonnenstand - wesentlich an Klarheit. |
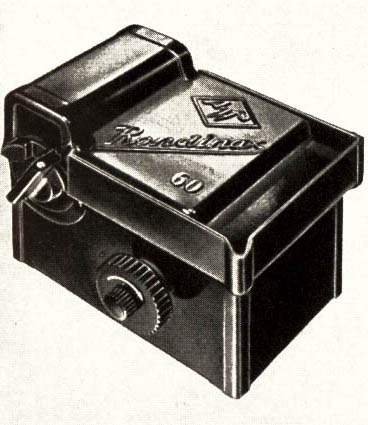 |
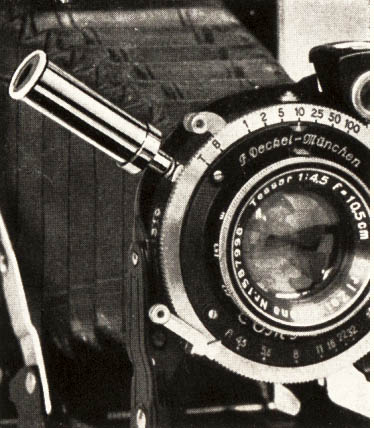 |
| 3.) Die auf S. 25 besprochene Entwicklungsdose (hier die Agfa Rondinax-Dose für 6/9). Eine Art Mikro-Dunkelkammer. Der Film wird bei vollem Tageslicht eingelegt, entwickelt,fixiert und gewässert. | 4.) Der klein Selbstauslöser "Direkt" (auch für 24/36 mm usw. zu haben). Arbeitet mit einer Glyzerinbremse. Von Selbstaufnahmen abgesehen, kann man mit ihm auch längere Momentzeiten (1!10.1/5 Sek.) sicherer als von Hand auslösen. |
Seite 27
zur
Inhaltsübersicht![]() zum
Stichwortverzeichnis
zum
Stichwortverzeichnis
Seite 28
zur
Inhaltsübersicht![]() zum
Stichwortverzeichnis
zum
Stichwortverzeichnis
II.
Licht und Farbe
Film und Filter
Seite 29
Licht und Farbe
Film und Filter
Foto-Grafie heißt Licht-Zeichnung, Licht-Schrift.
Wir müssen wissen, wie das beschaffen ist, was zeichnet und das,
worauf gezeichnet wird.
Was ist das: "Licht"? Was ist Farbe? Große Geheimnisse
sind es, von denen solch eine kleine Kamera umwittert ist. Licht und
Farbe sind Formen der elektromagnetischen
Energie, sagt der Physiker (denken Sie an die Radio-Wellen). Sinnesempfindungen,
Bewußtseins-Inhalte sagt der
Psychologe.
Auch das sind nur Worte für das Unbekannte. Das Wunder bleibt.
Vor allem haben wir die Frage falsch gestellt. Denn wir werden nie wissen,
was Licht wirklich "ist". Das Wunder sitzt an einer andern
Stelle in der "Empfangsanlage", die wir für gewisse elektromagnetische
Wellen in unserem Auge und unserem Gehirn besitzen. Diese Empfangsanlage
zaubert uns aus einer dunklen, von elektrischen Spannungen durchzuckten
Welt eine Welt des Lichts und der Farben vor.(Denn sofern wir logisch
denken: die Empfindung Licht, der Reiz Licht ist ja niemals gleichzusetzen
mit dem sie Auslösenden, dem Unbekannten.)
Und wenn wir fotografieren? Die
Spur zeigt, was hier zeichnete, was hier schrieb. Elektromagnetische
Stromstöße prallen auf die Bromsilber-Moleküle, stoßen
sie aus ihrem Gefüge, machen sie bereit zur völligen Spaltung
(nämlich durch "Entwicklung") in Brom und Silber. Übrig
bleibt das Silber-Bild, das negative Bild.
Was wir vom Lichte und den Farben - als Erscheinungen - mit Sicherheit
wissen, ist: daß sie nichts Einheitliches, sondern etwas sehr
Vielfältiges sind, roh gesagt ein Gemischtes.
Mit der schlichten Bromsilberschicht gehen wir an dieses Komplizierte
heran. Die Bromsilberschicht aber "sieht" Licht (und vor allem
Farben) keineswegs so wie wir.
Uns interessiert demnach: inwiefern sieht sie anders als wir? Und wie
zwingen wir sie, es zu sehen wie wir? Ja, ist es überhaupt möglich,
farbige Wirklichkeit befriedigend in Grautöne zu übertragen
und wo sind die Grenzen bei diesem Experiment?
Wir sind schon viel zu sehr an die graue Welt der Fotografie gewöhnt,
- aber jetzt, in diesem Augenblick nehmen wir einmal nichts mehr unbesehen
hin, wir beginnen überhaupt erst zu fragen, - und stoßen
dabei weit über das hinaus, was uns bisher rätselhaft oder
unabänderlich schien.
Seite 30
zur
Inhaltsübersicht![]() zum
Stichwortverzeichnis
zum
Stichwortverzeichnis
Es gibt kein "Licht"
Licht ist eine Sinnesempfindung, ausgelöst durch elektromagnetische
Schwingungen (Wellen). Wir haben nur für einen sehr kleinen Teil
des gesamten elektromagnetischen Wellenbandes Empfänger (Sinne).
Auf einen kleinen Ausschnitt des Wellenbandes spricht unser Empfänger
Auge an und bewirkt im Gehirn die Empfindung "Licht""
Dieser Teilausschnitt umfaßt die Wellenlängen von 400 bis
700 mµ (Millimikorn, 1 mµ = 1
millionstel mm). Es gibt viel größere Wellenlängen (bis
zu den technischen Wechselströmen von 6000 km Länge) und es
gibt unendlich viel kleinere
(bis zu den kosmischen Höhenstrahlen, deren Länge
unter 1billionstel mm liegt). Im ganzen aber ist unser Empfänger
Auge innerhalb "seines" kleinen Wellenbandes für viele
Wellenlängen empfindlich. Er meldet nicht nur Licht, er meldet
auch die "Stationen" des Lichtes. Über das Licht und
seine "Stationen", die Farben, müssen wir eingehender
sprechen.
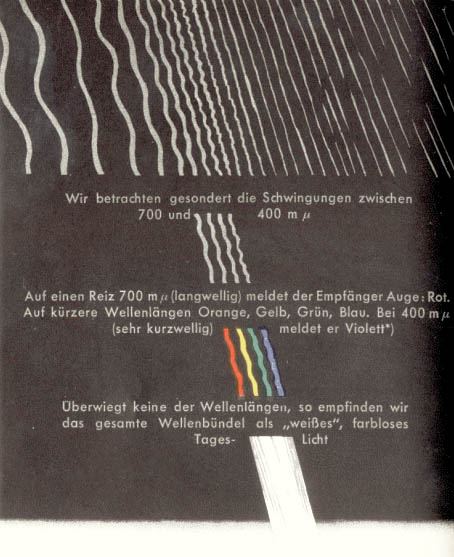
E s![]() w i r d
w i r d![]() h e l l !
h e l l !
*) Jenseits 700 m µ ( Rot ) liegt Infrarot , jenseits
400 m µ ( Violett ) liegt Ultraviolett ,beides Strahlen ,die schon
nicht mehr sichtbar sind .
zur
Inhaltsübersicht![]() zum
Stichwortverzeichnis
zum
Stichwortverzeichnis
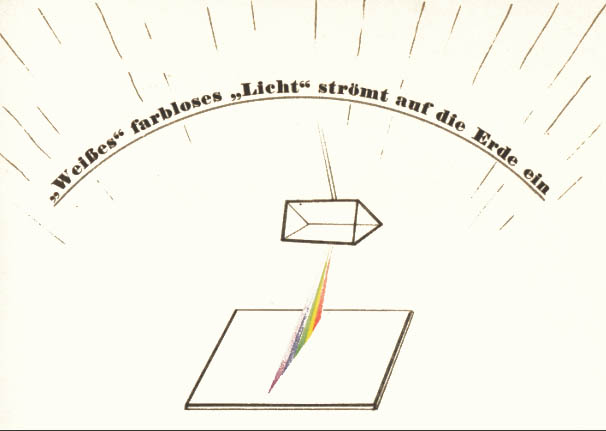
Wir können aber nachweisen,
daß unser Empfänger Auge die gleichzeitig sich meldenden
"Stationen" Rot, Gelb, Grün, Blau selbst zu "weißem"
Licht mischt. Schicken wir nämlich einen "weißen"
Lichtstrahl durch ein Prisma (das die verschiedenen Wellenlängen
verschieden bricht, so erscheint gespenstisch aus dem Fernen des Kosmos:
das Spektrum (lat. Das "Gespenst").
Diese Farben sind Spektralfarben, körperlose Farben.
 |
Aber auch die K ö r p e r f a r b e n (Pigmente) beweisen, daß "weißes" Licht aus Farben gemischt ist. Jeder Körper, den wir als farbig empfinden (also auch leuchtende Anilinfarbe) absorbiert, v e r s c h l u c k t den größten Teil ders weißen Mischlichtes und r e f l e k t i e r t den Rest. Dieser Rest ist "seine" Farbe. Ein rotes Kirchendach z. B. verschluckt alle Farben außer Rot, es "ist" rot. Gelbe Blumen "sind" gelb, da sie alle Farben verschlucken außer Gelb, blaue "sind" blau, da sie alle Farben verschlucken außer Blau. Farbe ist also stets durch Licht bedingt, im Dunkeln ist jeder Gegenstand völlig farblos. Ein Gegenstand kann auch stets nur eine Farbe haben, die in dem Licht enthalten ist, das auf ihn fällt (so sind z. B. im einfarbigen Rotlicht der Dunkelkammer alle grünen Gegenstände farblos schwarz, rotes Licht enthält kein Grün.Wer sich genauer über das Wesen der Farbe informieren will, findet auf Seite 191 eine ausführliche fotografische Farbenlehre. |
Seite 33
zur
Inhaltsübersicht![]() zum
Stichwortverzeichnis
zum
Stichwortverzeichnis
Die Fotografie überträgt
Farbwerte in Grauwerte. Da müssen wir zunächst fragen, ob
sie Fragen in die ihnen entsprechenden Grauwerte übersetzt, ob
sie "tonrichtig" arbeitet.

Im Idealfall würde sie
das in der hier aufgezeichneten Weise tun. Dieser Idealfall ist jedoch
nicht von Haus aus gegeben. Die fotografische Schicht empfindet Farben
in ihren Helligkeitswerten anders als unser Auge. Vor 20 bis 30 Jahren
waren fotografische Schichten in der Hauptsache für Blau und Violett
(das "aktinische" Licht)
empfindlich, sie gaben diese Töne auf dem Bild viel zu hell wieder
(da sie auf dem Negativ zu kräftig geschwärzt sind). Darauf
setzte man ihnen Farbstoffe zu, die das Blau dämpften und die Empfindlichkeit
für Gelb und Grün erhöhten. So
entstand die orthochromatische Schicht. Orthochromatische Schichten
sind jedoch nocht"rotblind", sie geben Rot als Schwarz wieder.
Man fand weitere Farbstoffe, die die Schicht auch für Rot empfindlich
machten. So entstanden die panchromatischen Schichten. Die Art, wie
eine fotografische Schicht auf Farben anspricht, ist also abhängig
von ihrer Behandlung mit Farbstoffen, ihrer "Sensitierung".
An einem einfachen Beispiel, einen Regenbogen, wollen wir zeigen, inwieweit
auch unsere panchromatischen Schichten von der "idealen" Farbwiedergabe
abweichen (wir werden
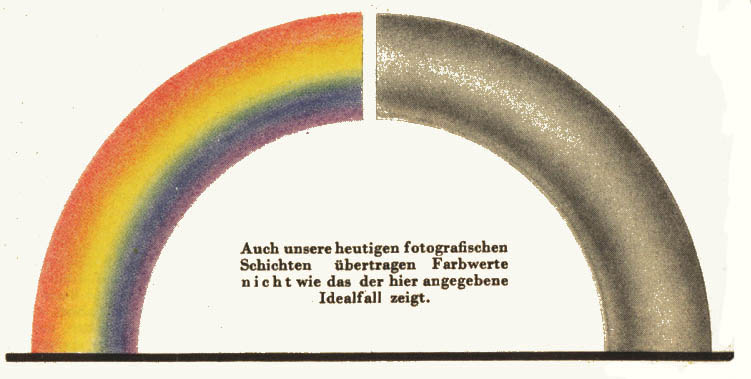
Später entdecken, daß dies merkwürdigerweise
kein Manko sein muß). Der Amateur von früher kannte nur eine
Schicht, die orthochromatische, der
Amateur von heute erhielt in der
panchromatischen Schicht ein Geschenk, das er in drei Sensitierungs-Typen
kennen muß.
Seite 34
zur
Inhaltsübersicht![]() zum
Stichwortverzeichnis
zum
Stichwortverzeichnis
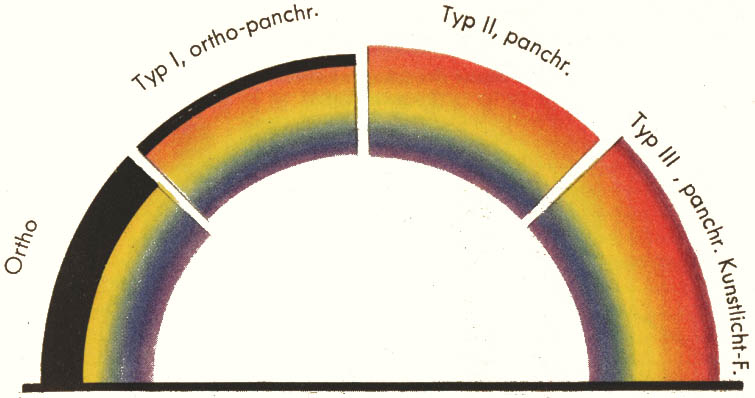
Das Schema zeigt, wie die verschiedenen Sensitierungs-Typen
(bei neutralem Tageslicht ) auf Farben ansprechen und wie diese Farben
(s. unten) fotografisch in Grauwerte übertragen werden. Wir interessieren
uns besonders für die panchromatischen
Typen I bis III.
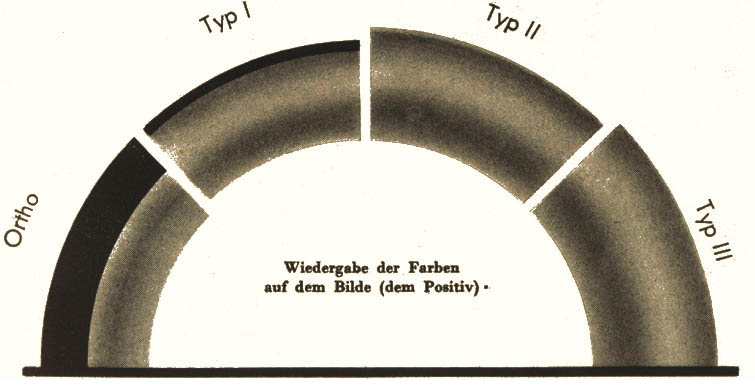
Ortho, rotblind, relativ hohe Blau-Violett-, mäßige
Grünempfindlichkeit.
Typ I*, meist nicht volle Rotempfindlichkeit
(die jedoch bei dem rötlich-geblichen elektrischen Licht, das wie
ein Orange-Filter wirkt, steigt, s.
S. 200)-
Typ II. (panchromatisch) hat meist eine schwache Überempfindlichekit
für Rot (infolgedessen eine zusätzliche Empfindlichkeit bei
elektrischem Licht, s.
S. 37).
Typ III, ein Spezialfilm für Kunstlicht
(meist hochempfindlich, 19-21/10º DIN), der für Rot und Orange
besonders hoch empfindlich ist und deshalb das gelblich-rötliche
elektrische Licht ganz besonders ausnützt. Dieser Typ (bzw. sein
Extrem) "bleicht" allerdings Rot-Töne (Haut, Lippen usw.
s.
S. 37, 188).
Typ III heute nur noch selten.**
Zusammenfassung: Der
in der Mitte liegende Typ II könnte als Universal-Film für
Tages- und Kunstlicht angesprochen werden. Allen panchromatischen Filmen
ist im übrigen die bessere Blaudämpfung eigen.
Filmfabrikate können in diesem Zusammenhang im einzelnen nicht
genannt werden. Jedoch auch als Amateur kann man durch Probeaufnahmen
(insbesondere Farbtafelaufnahmen s.
S. 36) den Grad der Rotempfindlichkeit eines panchromatischen
Films leicht nachprüfen. Auf S.
50 sind drei für ihren Typ charakteristische Vertreter
genannt.
* Meist als recte- oder ortho-panchromatisch bezeichnet.
** Neuerdings werden auch manche höchstempfindlichen Filme (z.
B. Isopan ISS) wie Typ I sensitiert.
Seite 35
zur
Inhaltsübersicht![]() zum
Stichwortverzeichnis
zum
Stichwortverzeichnis![]() weiter
weiter